Was wir über neue Medikamente nicht erfahren
Schon im Titel dieses englischsprachigen Buches steckt die grundlegende These: „The illusion of evidence-based medicine“. Illusionen, Trugbilder von evidenzbasierter Medizin? Hier waren Autoren mit Detailkenntnissen am Werk, hatten sie doch maßgeblich an der Aufklärung von zwei Medizinskandalen beigetragen. In ihrem Buch weisen sie auf grundsätzliche Probleme in der von der Pharmaindustrie gesteuerten Medizinforschung hin.
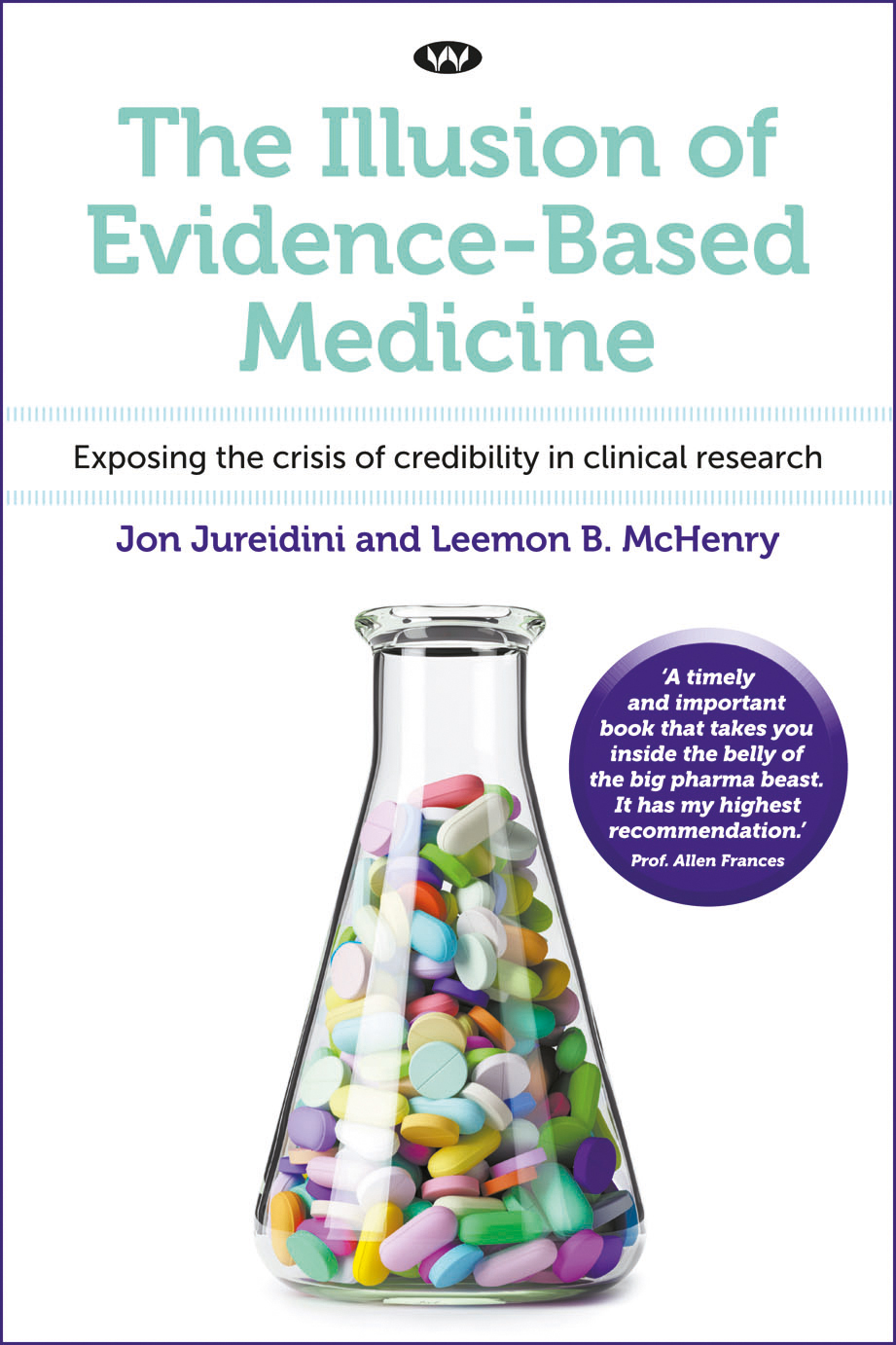
illusion of evidence-based medicine. Adelaide:
Wakefield Press. 330 S., 45 AUS$, auch als
E-Book (32,95 AUS$) erhältlich.
Im ersten Skandalfall geht es um die sogenannte „Study 329“ von GlaxoSmithKline, bei der das Antidepressivum Paroxetin an Jugendlichen getestet wurde. 2001 wurde die Studie mit angeblich positiven Ergebnissen veröffentlicht. Sie erlangte daraufhin eine wichtige Rolle in den Reihen der Befürworter von Medikamenten für depressive Jugendliche. Doch im Zuge von Gerichtsverfahren, in denen es um mögliche unerwünschte Wirkungen dieses Medikamentes wie etwa Suizid ging, stellte sich heraus, dass die Studienergebnisse für Paroxetin in Wirklichkeit enttäuschend waren. Es kam zu mehreren Schadensersatzzahlungen. Ferner wurde GlaxoSmithKline in einem Verfahren mit dem US-Justizministerium – unter anderem wegen der irreführenden Information über die Paroxetin-Studie – zu 3 Milliarden US-Dollar Geldstrafe verdonnert.
Die Autoren – Jon Jureidini, Professor für Psychiatrie und Pädiatrie an der Universität von Adelaide in Australien, und Leemon McHenry, emeritierter Professor für Philosophie an der California State University – waren an einigen der Gerichtsverfahren als Gutachter beteiligt. Am Beispiel der Studie 329 zeigen sie einige Tricks der Pharmaindustrie, um Medikamente besser aussehen zu lassen als sie sind. So wurde etwa das Präparat, mit dem man Paroxetin in der Studie verglich, zu hoch dosiert – mit der Folge von häufigeren Nebenwirkungen, und zack machte das neue Mittel Paroxetin im Vergleich eine gute Figur.
Trotzdem traten bei Paroxetin teils schwerwiegende Nebenwirkungen auf; dazu zählte etwa suizidales Verhalten. Diese wurden aber unter dem schwammigen Begriff „emotionale Labilität“ verschleiert oder in Einzelkategorien aufgeteilt, und schwupps galten sie jeweils als „selten“ oder wurden gar nicht erst erwähnt. Das Hauptproblem der Studie war aber, dass es statistisch keinen bedeutsamen Unterschied zwischen der Paroxetin- und der Placebogruppe bei der Wirksamkeit gab – wie zum Beispiel Rückgang von Symptomen der Depression –, die alle zu Studienbeginn definiert waren. Stattdessen wurden in der Veröffentlichung plötzlich andere Faktoren angeführt.
Schummeln bei der Auswertung
Die zweite Studie, „CIT-MD-18“ vom Hersteller Prescott, wurde 2004 veröffentlicht. Auch sie untersuchte ein Antidepressivum bei Jugendlichen: Citalopram. Die Veröffentlichung dieser Studie täuscht positive Schlussfolgerungen vor, so Jureidini und McHenry. Sie schloss nämlich acht Probanden in die Analyse ein, die nicht hätten berücksichtigt werden dürfen. Der Grund: Diese jungen Leute hatten mitbekommen, welches Medikament sie nehmen, obwohl sie eigentlich verblindet hätten sein sollen. Ohne Einschluss dieser Probanden war das Ergebnis statistisch unbedeutend. Trotzdem erlangte die Studie große Bedeutung für die Zulassung von Citalopram bei Jugendlichen.
Jureidini und McHenry vertreten die These, dass diese Fälle nicht außergewöhnlich sind, im Gegenteil: Nur weil aufgrund der gerichtlichen Auseinandersetzungen entscheidende Dokumente veröffentlicht werden mussten, die normalerweise geheim bleiben, offenbart sich hier, was regelmäßig geschieht.
Damit sehen die Autoren das Konzept der evidenzbasierten Medizin (EbM) insgesamt in Gefahr. EbM ist eine wissenschaftliche Art der Beurteilung medizinischer Behandlungen, die sich als Reaktion darauf versteht, dass sich viele etablierte medizinische Praktiken bei genauerer Prüfung als unwirksam erwiesen haben. Anstelle von Intuition und verzerrter eigener Erfahrung sollten sich Ärzt:innen vorzugsweise von wissenschaftlicher Evidenz leiten lassen – und für diese misst sie insbesondere den sogenannten randomisierten, kontrollierten klinischen Studien eine Kernrolle zu.
Studien mit „fairen“ Kontrollgruppen gehören zu den wichtigsten Entwicklungen der modernen Medizin, schreiben die Autoren. Durch ihren Aufbau sollen sie Verzerrungen von Ergebnissen so weit wie möglich ausschließen. Doch genau bei dieser Studienart sehen Jureidini und McHenry Probleme – wenn diese nämlich von Pharmaunternehmen kontrolliert und manipuliert werden, wie in den beiden beschriebenen Fällen. Damit wackelt das ganze Evidenz-Gefüge.
Pharmafirmen haben ein ökonomisches Interesse am „positiven“ Ausgang der Studien, die sie finanzieren. Schon mit dem Versuchsaufbau haben sie viele Möglichkeiten, die Ergebnisse in ihrem Sinn zu beeinflussen. Vor allem aber besitzen sie exklusiv die generierten Daten – und können deshalb bei der statistischen Auswertung Tricks anwenden, die für Außenstehende ohne Datenzugang nicht erkennbar sind.
Auf diese Weise geschönte Ergebnisse werden dann oft noch verzerrt zusammengeschrieben – und zwar häufig nicht von den als „Autor:innen“ genannten Wissenschaftlern, sondern von „Ghostwritern“ der Firma. Die offiziellen „Autor:innen“ wurden dabei unter dem Gesichtspunkt ausgewählt, der Studie wissenschaftliches Renommee zu verschaffen.
Fachzeitschriften, die solche Studien veröffentlichen, können diese ohne Zugang zu den Originaldaten nicht überprüfen. Überhaupt fehlt der Anreiz, hier genau hinzuschauen. Denn die Fachblätter haben meist selbst ein finanzielles Interesse an guter Zusammenarbeit mit der Industrie: Die Firmen schalten nämlich einträgliche Werbung in den Zeitschriften, und kaufen außerdem für die Vermarktung ihrer Präparate bei Ärzt:innen Sonderdrucke „ihrer“ Artikel, und das teils für Millionenbeträge. Unfassbar: Auch die beiden besprochenen Skandal-Studien stehen immer noch unverändert in den Fachzeitschriften und werden, da sie nicht zurückgezogen wurden, weiterhin mit ihren manipulierten Ergebnissen zitiert.
Studien, die wissenschaftliches Fehlverhalten und Manipulation Industrie-gesponserter Studien aufdecken, werden dagegen regelmäßig von den Zeitschriften abgelehnt, schreiben Jureidini und McHenry. Die Autoren bezeichnen daher diese Journals als Mittel der „Informationswäsche“, die dubiose Studien reinwaschen und damit ein Hindernis für wissenschaftliche Wahrheit seien.
Die bisherigen Maßnahmen, um die Missstände zu beseitigen – Offenlegung von Interessenkonflikten, Studienregistrierung, Beschränkungen des Pharmamarketings – kratzen laut Jureidini und McHenry bloß an der Oberfläche. Sie schreiben: „Wir können uns keine überzeugende Lösung für die in diesem Buch aufgezeigten Probleme vorstellen, wenn nur diejenigen mit einem Eigeninteresse Zugang zu den Primärdaten haben.“
Es muss schon eine radikale Lösung sein, eine kleine Revolution. Klinische Studien sollen nicht mehr von Pharmafirmen durchgeführt, sondern künftig als Aufgabe der öffentlichen Gesundheitsversorgung begriffen werden. Das würde auch dazu beitragen, dass mehr in den Gebieten geforscht wird, wo es die größten Behandlungslücken gibt. Wenn das nicht gelingt, sollten zumindest bei der Zulassung von Medikamenten die originalen Studiendaten von einem unabhängigen Forschungsgremium analysiert werden.
Davon sind wir noch weit entfernt. Für Patient:innen bedeutet die ernüchternde Lektüre: Eine gesunde Dosis Skepsis gegenüber großspurigen Versprechungen der Industrie ist mehr denn je angebracht. Darum sind kritische Informationen aus unabhängiger Quelle wichtig – zum Beispiel Gute Pillen – Schlechte Pillen.
Verblindung
GPSP 3/2019, S. 10
Stand: 30. April 2021 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2021 / S.12
