Zitronen gegen Skorbut: Die erste kontrollierte Studie
Wie James Lind die medizinische Wissenschaft voranbrachte
Ein schottischer Schiffsarzt fand nicht nur ein wirksames Mittel gegen eine Krankheit, die viele britische Seeleute im 18. Jahrhundert dahinraffte, sondern etablierte auch eine neue Forschungsmethode.
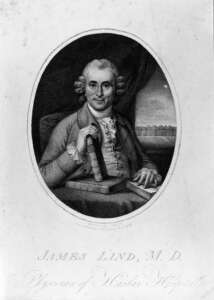 Am 20. Mai 1747 entschloss sich James Lind zu einem wegweisenden Experiment.1 Er war seit März als Schiffsarzt auf der HMS Salisbury unterwegs, die in den Gewässern zwischen England und Frankreich patrouillierte.
Am 20. Mai 1747 entschloss sich James Lind zu einem wegweisenden Experiment.1 Er war seit März als Schiffsarzt auf der HMS Salisbury unterwegs, die in den Gewässern zwischen England und Frankreich patrouillierte.
Acht Wochen nachdem das Schiff in See gestochen war, lag bereits jeder Zehnte der 350 Seeleute krank an Bord. Sie litten unter blutendem Zahnfleisch, ausfallenden Zähnen, hatten ständig Infektionen und waren müde und erschöpft. Außerdem heilten ihre Wunden schlecht, ihre Knochen und Muskeln bauten ab, und sie drohten an Herzschwäche zu sterben.
Nicht nur auf der HMS Salisbury bekamen Seeleute diese rätselhafte Krankheit, die Skorbut genannt wird, und von der wir heute wissen, dass sie durch Vitamin C-Mangel entsteht. Die englische Marine verlor nach zeitgenössischen Einschätzungen mehr Matrosen an Skorbut als im Kampf gegen Frankreich und Spanien. Der wichtigste Grund dafür: Die schlechte Versorgung mit frischen Nahrungsmitteln – besonders bei längeren Einsätzen auf See ein großes Problem.
Was hilft gegen Skorbut?
James Lind wusste allerdings nichts über Vitamin C – das Konzept von Vitaminen war zu dieser Zeit noch nicht bekannt. Wie sich Skorbut entwickelt, wurde deshalb kontrovers diskutiert. Eine Theorie ging davon aus, dass die Krankheit durch Fäulnisprozesse im Körper ausgelöst wird, die sich mit Säuren bekämpfen lassen. Die Mediziner des Royal College of Physicians schworen deshalb auf Schwefelsäure; die Admiralität der englischen Marine bevorzugte hingegen die Behandlung mit Essig. Einzelne Ärzte empfahlen saure Zitrusfrüchte.
Welche dieser Behandlungen bei Skorbut wirklich half, oder ob eine besser war als die andere, war jedoch völlig unklar. Da griff James Lind zur Selbsthilfe und startete ein Experiment, das nicht nur den Seeleuten half, sondern auch die medizinische Forschung voranbrachte.
Die erste kontrollierte Studie
Lind brachte zwölf der an Skorbut erkrankten Seeleute auf demselben Deck unter und versorgte sie mit derselben Nahrung. Dann teilte er die zwölf Kranken in sechs Gruppen zu je zwei Seeleuten ein. Die erste Gruppe bekam zusätzlich ein Viertel Apfelwein pro Tag, die zweite verdünnte Schwefelsäure dreimal täglich auf nüchternen Magen. Der dritten Gruppe ließ Lind zwei Löffel Essig am Tag geben, der vierten Gruppe ein halbes Pint Meerwasser – das entspricht 284 Millilitern. Die fünfte Gruppe aß pro Tag zwei Orangen und eine Zitrone, die sechste Gruppe eine Paste aus Knoblauch, Senf, Meerrettich und einigen anderen Zutaten.
Etwa zwei Wochen später, Ende Mai, stellte Lind fest, dass es zwei Seeleuten wesentlich besser ging als den anderen. Einer von ihnen konnte sich sogar zurück zum Dienst melden, der andere konnte sich um die Kranken kümmern. Das waren die beiden, die Zitrusfrüchte bekommen hatten.
Zitronen, Limettensaft, Sauerkraut
Damit hatte Lind die wirksamste Behandlung gegen Skorbut gefunden, auch wenn er den Grund dafür, nämlich den hohen Vitamin C-Gehalt, damals noch nicht kannte.
Sechs Jahre später beschrieb er das Experiment in einem Buch, das auch ins Französische, Italienische und Deutsche übersetzt wurde. Allerdings dauerte es weitere 42 Jahre, bis sich die Erkenntnisse aus Linds Experiment zur Skorbut-Behandlung in der britischen Marine durchsetzen konnten. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gehörten Zitronen- und Limettensaft, später auch Sauerkraut, zur Standardversorgung von Seeleuten und der Skorbut in der Seefahrt galt als besiegt.
Was kontrollierte Experimente bringen
Auch wenn Linds Experiment nach heutigen Standards für allgemeingültige Aussagen viel zu wenige Patienten umfasste, ist seine Methode für den Test von Behandlungen dennoch bedeutsam: Weil sie Behandlungen direkt miteinander vergleicht. Heute würde man das eine „kontrollierte Studie“ nennen.
Die Idee dahinter: Nehme ich ein Medikament ein und es geht mir danach besser, weiß ich nicht, ob das tatsächlich an dem Arzneimittel liegt. Vielleicht wären die Beschwerden auch ohne Behandlung verschwunden. Oder ich fühle mich nicht mehr so schlecht, weil ich überhaupt etwas eingenommen habe. Bei der reinen Beobachtung können also sowohl der natürliche Krankheitsverlauf als auch ein Placebo-Effekt den Eindruck verzerren. Unter anderem aus diesem Grund sind die Ergebnisse von Anwendungsbeobachtungen wenig aussagekräftig.
Wird das Medikament aber in einer Studie mit einer Kontrollgruppe getestet, die mit der Behandlungsgruppe vergleichbar ist und bei der alle Rahmenbedingungen gleich sind, wird die Beobachtung deutlich zuverlässiger.
Faire Vergleiche
Auf die Vergleichbarkeit hatte bereits James Lind geachtet: Er testete die Behandlungen an Seeleuten mit vergleichbaren Krankheitssymptomen. Ansonsten wären die Ergebnisse leicht verzerrt worden: Etwa, wenn nur Patienten Zitronen bekommen hätten, die bereits im Sterben lagen, oder er Schwefelsäure nur an Seeleute verabreicht hätte, die nicht so schwer erkrankt waren. Um die Bedingungen während des Versuchs gleich zu halten, hielt Lind Unterbringung und Verpflegung exakt gleich. So konnte er sicherstellen, dass der einzige Unterschied zwischen den Seeleuten die Art der Behandlung war.
In modernen Studien gelten viele dieser Grundsätze immer noch. Um die Vergleichbarkeit von Behandlungs- und Kontrollgruppe noch besser zu gewährleisten, gehört es heute aber zusätzlich zum Standard, die Teilnehmenden nach dem Zufallsprinzip („randomisiert“) auf die Gruppen zu verteilen.2
https://gutepillen-schlechtepillen.de/kontrolle-ist-besser/
Stand: 2. Mai 2022 – Gute Pillen – Schlechte Pillen 03/2022 / S.22
